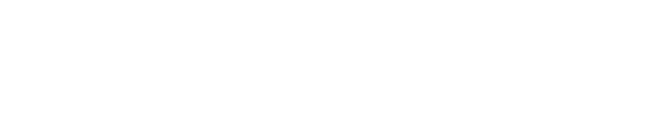Der Vatikan in der Corona-Krise
Kardinal Walter Kasper
Wenn ich über den Vatikan in der Corona-Krise berichten soll, dann zwingt das mich über etwas zu berichten, was es eigentlich gar nicht geben kann, eine Kirche ohne Volk Gottes und ein Papst, der sich halb scherzhaft als in einem Käfig eingesperrt bezeichnet. Ostern, das Hochfest der Christenheit, in Rom ohne einen öffentlichen Gottesdienst. Das hat es in fast 2000 Jahren Kirchengeschichte wohl noch nie gegeben. Böse Zungen denken im Blick auf den menschenleeren Petersplatz und die zugeschlossene Peters-kirche vielleicht sogar an Friedrich Nietzsches Spott über die Kirchen als Mausoleen eines toten Gottes.
Doch so ist es nicht. Natürlich finden in der Peterskirche und in der Privatkapelle des Papstes Gottesdienste statt, und sie werden dank der modernen elektronischen Möglichkeiten auch in alle Welt gestreamt und von unzähligen Christen dankbar mitgefeiert. Doch kann oder soll man vor dem TV-Schirm niederknieen, wenn der heiligste Moment der Eucharistiefeier, die Wandlung übertragen wird? Sakramente sind nach amtlicher Definition sichtbare Zeichen; sie lassen sich elektronisch übertragen aber nicht wirklich vergegenwärtigen. So geht die gegenwärtige Situation ans Mark und an den Nerv der Kirche, die sich als sichtbare sakramentale Gemeinschaft versteht.
So ist es mehr als ein wehmütiges Gefühl, wenn man nahe beim Petersplatz wohnt, wo es sonst vor allem zur Osterzeit von Touristen, darunter auch wirkliche Pilger, nur so wuselt, jetzt aber eine geradezu gespenstische Leere und Stille herrscht. Es ist sicher auch nicht nur ein sehr ernsthaftes finanzielles Problem des Vatikan, wenn die langen Menschenschlangen ausbleiben, die Eingang in die Vatikanischen Museen verlangen, seit zwei Monaten plötzlich wie weggeblasen sind. Auch die Vatikanischen Behörden, die sogenannten Dikasterien und das Staatssekretariat, arbeiteten seit fast zwei Monate nur mit höchstens halber Kraft, teilweise auch im Home-Office; erst seit dieser Woche soll die Arbeit wieder voll aufgenommen werden, natürlich unter Beachtung des gebotenen Abstands- und Hygieneregeln. Große Gottesdienste und Generalaudienzen mit dem Zustrom von hunderten und tausenden Menschen werden aber wohl noch längere Zeit auf sich warten lassen müssen. Wenn das einem besonders weh tut, dann ist es Papst Franziskus, der so gerne nahe bei den Menschen sein will.
Um so eindrucksvoller war für mich der Abend, an dem der Papst auf dem menschenleeren und regennassen dunklen Petersplatz den Segen den Segen Urbi et Orbi gespendet hat. Das Pestkreuz von San Marcello al Corso, das man im Pest-Jahr 1522 unter großer Beteiligung durch die Straßen von Rom getragen hat, jetzt stand der Papst allein davor. Man merkte ihm die Last, die auf ihm ruht, an. Seine Worte, äußerlich wie ins Leere hineingesprochen, aber über die Medien weltweit gehört trafen ins Herz und gaben eine christliche Deutung der Krise. Bemerkenswert vor allem, dass er den feierlichen Segen nicht in der gewohnten Form durch ein Kreuzzeichen mit der Hand sondern mit der Monstranz mit dem Allerheiligsten gab. Damit machte er anschaulich deutlich, woher in dieser Situation Segen, Kraft, Trost und Hilfe kommen.
Die Italiener sind spontan und in schwierigen Situationen auch erstaunlich kreativ. „Arrangiarsi“, sich arrangieren und sich einzurichten wissen, ist ein wichtiges italienischen Wort. Viele Pfarreien streamen ihre Gottesdienste. Es gibt berührende Berichte von geradezu heldenhaften Einsatz von Krankenpflegern, Ärzten und Priestern, sozialen Aktivitäten; allein in Rom müssen ja auch in Corona-Zeiten etwa 8000 Obdachlose versorgt werden, die man auch rund um den Vatikan und direkt vor meiner Haustür antrifft. Auch sonst ist die Versorgung von Bedürftigen und jetzt der zunehmenden Zahl der Arbeitslosen nicht mit Deutschland zu vergleichen. Der Kardinal-Elemosionere (wörtlich: für Almosen, konkret: für die Päpstlichen Werke der Barmherzigkeit zuständig) hat darum einen dringenden Spendenaufruf an alle Kardinäle gerichtet. Die römische Caritas, Sant’Egidio, viele Pfarreien und Konvente haben ihre Aktivität verstärkt.
Die Krise stellt wie in aller Welt auch im Vatikan nicht nur praktische, sondern auch grundsätzliche Fragen: Wie Kirche sein in Corona-Virus-Zeiten? Die Wiederzulassung von öffentlichen Eucharistiefeiern, wenngleich bis auf weiteres mit beschränkten Teilnehmerzahlen, ist kirchlich ein dringendes Thema. Es stellt sich freilich auch die Frage: Wie soll es nach Corona-Virus-Zeiten weitergehen? Wohl alle Einsichtigen sind sich bewusst: Es wird nachher nicht einfach wieder so sein wie es vorher war. Die Corona-Krise ist ein tiefer und massiver Einschnitt im privaten wie auch im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Leben. Sie hat uns die Verletzlichkeit und Ausgesetztheit des Menschen neu bewusst gemacht, gegen die wir auch mit modernster Medizin und Technik nur sehr begrenzt gewappnet sein können. Sie ist eine grundsätzliche Anfrage an unsere Zivilisation und unseren gewohnten Lebensstil. Sie stellt uns auch als Christen und als Kirche grundsätzliche Fragen: Was ist wirklich wichtig und wesentlich? Und was sind nur aufgesetzte Fragen und Probleme?
Vielleicht interessiert es noch, wie es mir in den letzten zwei Monaten gegangen ist. Da ich eindeutig der Risikogruppe angehöre, bin ich brav in meiner Wohnung geblieben Zum Glück habe ich eine eigene Hauskapelle, in der ich jeden Tag, auch an den Kar- und Ostertagen zusammen mit ein paar Schwestern, die sich im Haus befinden, zelebrieren konnte. Wie die meisten Palazzi hat das Haus ein Flachdach mit einer Terrasse, auf der man etwas frische Luft schnappen und südländische Sonne genießen kann. Wie allen anderen fehlt mir, dass ich keine Besucher zu Gesprächen empfangen kann; aber mit Büchern und am Schreibtisch kann ich mich auch ganz gut selbst beschäftigen. Soweit ist alles o.k.
Nur ein belastendes Problem möchte ich loswerden. Die Italiener sind über uns Deutsche derzeit recht enttäuscht und teilweise, besonders in den Medien sehr schlecht zu sprechen. Das tut weh. Als Hauptbetroffene von der Krise fühlen sie sich von uns allein gelassen. Das Problem ist, wie ich wohl weiß, vielschichtig. Doch die Corona-Virus-Krise ist auch eine Herausforderung an die europäische Solidarität, die nicht zum Null-Tarif zu haben ist. Wir Deutsche, denen es wesentlich besser geht als den meisten Italienern, sollten uns bewusst sein: Ohne Rom und seine historische, kulturelle wie vor allem kirchliche Bedeutung kann man sich die Integration Europas nicht denken, und wenn wir nach der Krise wieder nach Rom und Italien kommen, möchten wir ja auch gerne gesehen und willkommen sein. Von der römischen Lebensart können wir Deutsche ohnedies auch manches lernen.