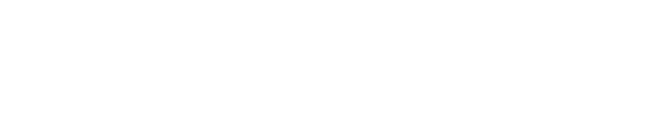Wort zum Sonntag, 5. April 2020
Als Papst Franziskus am Freitag, den 27. März, abends um 18 Uhr vor aller Welt eine eucharistische Andacht hielt und diese mit dem Segen „Urbi et Orbi“ abschloss – ging mir aufs Neue die doppelte Realität unserer Römisch-Katholischen Kirche auf: Auf der einen Seite die ganze Pracht des Petersdoms und das gewaltige Rund des Petersplatzes mit seinen Kolonnaden – auf der anderen Seite die einsame Gestalt eines ganz in Weiß gekleideten Menschen, umrahmt von einigen wenigen mitbetenden Prälaten, intensiv und mühsam die einzelnen Stationen abschreitend, in einer langen meditativen Stille ganz in sich versunken, und am Ende den Segen durch die Leere des Raumes drinnen wie draußen hinaussendend in alle Welt.
Hier spürte ich etwas von den visionären Ahnungen einer Gertrud von Le Fort in ihren „Hymnen an die Kirche“ (Passion I). Dort lässt sie die Stimme der Kirche sprechen:
Fürchte dich nicht vor meinen goldnen Kleidern und erschrick nicht vor den Strahlen meiner Kerzen.
Denn sie sind alle nur Schleier meiner Liebe, sie sind alle nur wie zärtliche Hände über meinem Geheimnis!
Ich will sie fortziehen, weinende Seele, damit du erkennst, dass ich dir nicht fremd bin.
Wie sollte eine Mutter nicht ihrem Kind gleichen?
Alle deine Schmerzen sind in mir!
Ich bin aus Leiden geboren, ich bin aufgeblüht aus fünf heiligen Wunden,
Ich bin gewachsen am Baum der Schmach, ich bin erstarkt am bittren Wein der Tränen –
Ich bin eine weiße Rose in einem Kelch voll Blut!
Ich lebe aus dem Leid, ich bin eine Kraft aus dem Leid, ich bin eine Herrlichkeit aus dem Leid:
Komm an meine Seele und sei daheim!
Im Blick ist eine suchende und von tiefen Zweifeln heimgesuchte Menschheit. Die Dichterin weiß sich selbst als einen Teil davon, und sie hat ihre Konversion noch vor sich. Sie anerkennt die enorme Wirkung einer in Gold und Brokat daherkommenden Kirche, die sich auch heute noch in einer Weise zu inszenieren weiß, die die einen beeindruckt, die anderen abstößt, wieder andere neidisch macht. Aber ist es diese Pracht, auf die es ankommt?
Die Kirche hat sich der Kultur der Jahrhunderte einverleibt, und sie musste es tun, um sich bemerkbar zu machen und ihre Relevanz zu demonstrieren – freilich immer auf die Gefahr hin, ihren Wesenskern dadurch hintanzustellen oder zumindest zu relativieren. Die suchende Dichterin entdeckt eine Kirche, deren „Stimme“ aus ihrem innersten Herzen hervorbricht und fast beschwörend dazu aufruft, doch bitte nicht die eigentliche Botschaft zu verkennen, für die die Kirche steht.
Vielleicht übersieht Gertrud von le Fort in ihrer Entdeckerfreude doch ein wenig die bittere Realität der Sünde, mit der die Kirche ihre Kleider, so prächtig sie auch sind, im Lauf der Geschichte bis in die heutige Missbrauchskrise hinein selbst besudelt und verdreckt? Oder weiß sie besser als wir, dass eine Kirche, die sich im Gefolge Jesu auf die Welt einlässt, dies gar nicht anders tun kann als auf die Gefahr einer sündhaften Verstrickung in das mannigfaltige Böse hin?
So schwer die Corona-Pandemie derzeit auf den Seelen der Menschen lastet und alles normale Wirken der Kirche in verheerender Weise unterbricht – so sehr scheint mir darin etwas sehr Wesentliches aufzuleuchten, das den Ahnungen der Dichterin auf überraschende Weise entspricht: Dass die Menschen erkennen, wie nahe ihnen diese Kirche doch im Grunde ist, wie wenig Sonderrechte sie genießt und wie bitter sie stets aufs Neue um ihre eigene Existenz ringen muss. Wie sie sich – auch ohne die übliche liturgische Entfaltung des österlichen Triduum – ihrer Zugehörigkeit zu dem leidenden und geschmähten Herrn bewusst wird und so in ihrem eigenen Leid die Herrlichkeit des Auferstandenen entdeckt, die so viel mehr ist als die wirkungsvolle Szenerie des Petersdoms.
In aller Armut und Gebrechlichkeit wie Papst Franziskus die Stationen unserer Hoffnung abschreiten und – vielleicht eher im Schweigen als im medialen Wortschwall – die existenzielle Bedeutsamkeit des Kreuzes zu erfassen: das könnte Ostern 2020 bedeuten – und der Palmsonntag könnte der geeignete Auftakt dazu sein. Zwischen dem „Hosanna“ der (zwar ausfallenden aber vielleicht in unseren Häusern begangenen) Prozession und dem anschießend nach Matthäus erzählten „Leiden unseres Herrn Jesus Christus“ besteht kein Widerspruch, sondern ein innerer Bezug; denn was es wirklich bedeutet, wenn der „Sohn Davids“ „im Namen des Herrn“ in Jerusalem Einzug hält, wird nirgendwo anders in Erscheinung treten, als in den „fünf heiligen Wunden“ und dem „Kelch voll Blut“ im Hymnus der Gertrud von le Fort.
Und sicher wird auf keine andere Weise die Kirche wieder „aufblühen“ und „erstarken“ als im Geheimnis des Kreuzes.
Alfons Knoll