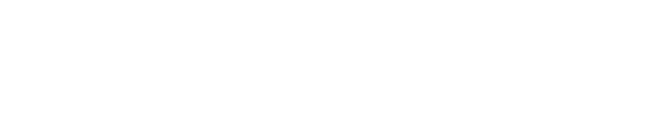Mooshauser Ostertagebuch 2020
Notizen von Christa Krämer
Es ist der 10. April 2020. Karfreitag. Ein außergewöhnlicher Karfreitag, wie wir ihn noch nie vorher hatten. Zumindest nicht zu meinen Lebzeiten, und das sind immerhin auch schon etwas über zweiundsechzig Jahre. Seit Wochen hält das Corona-Virus die Welt gefangen.
In Deutschland gelten Kontaktsperren in unterschiedlichen Ausprägungen, in anderen Ländern gibt es sogar Ausgehverbote. Die Kirchen sind zwar tagsüber geöffnet. Aber Gottesdienstfeiern mit den Gemeinden sind untersagt. Die Karfreitagsliturgie muss zu Hause übers Internet verfolgt werden – so man über einen PC verfügt. Angebote via Livestream gibt es zu Hauf. Aber auch im Fernsehen gibt es entsprechende Übertragungen. Noch gibt es Mitmenschen, denen PC, Laptop, Handy, Smart- oder iPhone fremd sind.
Nach Karfreitag ist mir angesichts des frühsommerlichen Sonnentags nicht wirklich zumute. Und doch ist es der stillste Karfreitag, den ich je erlebt habe. Ich weile in Mooshausen, diesem noch immer beschaulichen Dörfchen im schwäbischen Allgäu. Außer Vogelgezwitscher, gelegentlichem Muhen aus dem benachbarten Kuhstall und dem viertelstündlichen Glockenschlag der Kirchturmuhr von St. Johann Baptist ist nichts zu hören. Na ja, ab und zu ein vorbeifahrendes Auto, vorne auf der Durchgangsstraße, oder das Lärmen eines Motorrads, das vorbeirauscht – erst leise, dann lauter werdend, schließlich Richtung Aitrach oder Tannheim verhallend.
Der Osterzopf kühlt, frisch gebacken, auf dem Kuchenrost aus, die Eier sind bunt gefärbt. Nach einem für Karfreitag fast schon zu üppigen Mittagsmahl – es gab geräucherte Forelle, kurz in der Pfanne in frischem Zitronensaft angeschwenkt, etwas Zucchini-Spargel-Paprika-Gemüse und einen kleinen Rest Kartoffelsalat vom Gründonnerstag – kann ich endlich einen ausgiebigen Spaziergang unternehmen. Als Tagungsverantwortliche bleibt mir dafür ansonsten keine Zeit, und auch während unserer Arbeitsaufenthalte in den zurückliegenden drei Jahren war an Bewegung an der Frischluft rund um Mooshausen nicht zu denken.
Ich gehe, vorbei am alten Schulhaus, hinunter zum Illerkanal, überquere ihn und nehme den Waldweg rechter Hand Richtung Wehr. Auch wenn man beinahe zuschauen kann, wie das Grün aus allen Knospen quillt, ist es doch noch verhalten und spärlich. Angenehmen Schatten kann es noch nicht spenden. Dafür ist der Blick jedoch frei auf die gemächlich dahinfließende Iller zu meiner Linken (Bild 1), auf der sich Enten, Schwäne und sogar eine Möwe tummeln. Am gegenüberliegenden Kiesstrand fangen einzelne Nestflüchter die sehr warmen Sonnenstrahlen ein, ihre Räder stehen oben am Ufer, an Bäume angelehnt oder ins noch kurze trockene Gras geworfen.
Zum ersten Mal in den dreizehn Jahren, die ich jetzt schon hierherkomme, überquere ich das Wehr (Bild 2). Ich wende mich nach links Richtung Tannheim wie ich denke und marschiere munter weiter, die grün-bläulich schimmernde, in der Mittagssonne glänzende Iller im Blick. Die Ufer hinab zum Wasser sind steil, und ich denke, dass ich mich ohne einen stützenden Stock als sicheren Halt auf dem rutschigen Kies nicht hinunter trauen würde (Bild 3). Bergab war für mich schon immer ein großes Problem. Nie hatte ich es gewagt, die satten Wiesen am Bergweg in meinem Heimatdorf kindlich-unbedarft und vor Freude jauchzend hinunterzurennen, wie das alle anderen Kinder getan haben.
Auf dem ausgetrockneten Waldweg knirscht der Kies unter den breiten Reifen der Bikes, die mir entgegenkommen oder mich überholen. Die Luft ist so rein. Ich könnte stundenlang weitergehen, wären da nicht die leicht aber stetig von der maroden Bandscheibe her ausstrahlenden Schmerzen im rechten Bein. Könnte ich sie doch weg laufen! Bewegung soll guttun, heißt es immer seitens der Mediziner. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie, je länger ich marschiere, schlimmer werden. Nun gut, die nur noch dünne Bandscheibe lässt sich nicht mehr anreichern, und auch die Verknöcherungen am Wirbel trollen sich wohl kaum wie von Zauberhand.
Schnell weg also mit den trüben Gedanken, guten Mutes Schritt für Schritt voran und alles aufnehmen und genießen, was um mich herum wahrnehmbar ist. Zum Beispiel das saftig grüne Moos, das die vielen herumliegenden Äste und kleineren Baumstämme überzogen hat. Es leuchtet frühlingsfroh in der Sonne und lässt mich an den Osterhasen denken. Unsere Osternester der Kinderzeit waren mit solchem Moos ausgebettet. Und wie das duftete! Ich bleibe kurz stehen, atme tief ein und erahne diesen erdigen Geruch aus einer unbeschwerten Vergangenheit. Wie haben wir, mein jüngerer Bruder Reinhold und ich, uns stets bekümmert, ob das Wetter halten würde oder umschwenkt, damit wir unsere Osterkörbchen im Freien suchen konnten. Natürlich wussten wir längst, dass unser Vater als Osterhase agiert hat. Aber es war einfach näher am Kinderglauben, sein Körbchen hinterm Forsythienstrauch, neben der kleinen Mauer, die den Hof vom Rasenstück trennte oder hinterm Haus unterm schon grünen Blätterdach des Pfingstrosenbuchs zu entdecken, als im Keller in der großen grauen Mehltruhe, hinter der Waschmaschine oder neben dem brummenden, summenden Brenner der Ölheizung. Ganz zu schweigen von der, aus Kinderaugen betrachtet, Düsternis und Fraglichkeit dieses dunklen Ortes, an den sich die Sonne niemals verirrt.
Ich gehe weiter parallel zur Iller, immer in der Annahme, es müsse bald ein Steg oder eine Brücke zurück auf die andere Seite geben. Es ist ja das erste Mal, dass ich diesem Weg folge. Muss ich etwa wieder umkehren, um zurück nach Mooshausen zu gelangen?
Die großen Wegmarken, im Zweihundert-Meter-Abstand eingehauen ins Unterholz, sagen mir, dass ich bereits zwei Kilometer hinter mir habe. Aber weit und breit kein Hinüberkommen. Die zahlreichen Bäume auf dem Uferwall verhindern den Weitblick. Wie gut, dass ich doch noch auf Anraten von Klaus, meinem immer sich sorgenden Ehemann, das Handy in die Tasche gesteckt habe. Nicht nur, dass ich es schon für einige Fotoaufnahmen im Einsatz hatte – das gründelnde Schwanenpaar nahe des Wehrs zum Beispiel musste ich einfach einfangen (Bild 4 u. 4a). Es hilft mir jetzt herauszufinden, dass erst in Arlach ein Ende absehbar ist. Doch bis dahin sind es noch einige Kilometer. Eine ausgedehnte Wanderung habe ich nicht im Sinn.
Ich drehe also um, folge dem Weg zurück zum Wehr, wechsle von der Iller zum schnurgerade dahinschleichenden Illerkanal, an dem sich schon Josef Weiger und Romano Guardini gern die Beine vertraten, um ihre Köpfe frei zu bekommen oder, so wie ich heute, neue Impulse und Inspirationen für ihre geistige und geistliche Arbeit aufzulesen. Ich sehe sie vor mir, gleich meinem Lieblingsbild, zwei ältere, feine, honorige Herren, eingehakt der eine beim anderen, Spazierstöcke in den knochigen Händen, leichte Sommeranzüge und die unvermeidlichen schwarzen Hüte auf dem betagten weisen Haupt. Worüber sie wohl eben grübeln? Was triebe sie heute um? Dieser Karfreitag etwa, an dem sie ihre Liturgie in trauter Pfarrhaus-Dreisamkeit feiern müssen? Oder dieses Virus, das alles öffentliche Leben lähmt und die Wirtschaft in eine Rezession spült? Fragen sie sich wie ich, wie das wohl weitergehen wird die nächsten Wochen und Monate? Oder freuen sie sich einfach nur am Anblick des eben aufgetauchten Schmetterlings, ein Admiral übrigens, der fröhlich und munter in der Hitze dieses Aprilnachmittags ein lustiges Tänzchen entlang der den Spazierweg säumenden Büsche vollführt und den beiden zottigen Pferden auf der nahen Weide – das eine pechschwarz, ein Teil der Mähne zu einem Zopf geflochten, das andere wollweiß mit großen schwarzen Flecken (Bild 5) – um die Nasen flattert?
Überm Wasser drüben schlägt die Kirchturmuhr zwei Mal. Halb vier. Kaffeezeit. Die beiden Seelenverwandten machen einem weiteren Schwanenpaar Platz (Bild 6). Sie führen im Himmel ihr Freundschaftsgespräch weiter.
Ich kehre zurück zum Pfarrhaus, nehme den Weg durch den Pfarrgarten und schließe die hintere Pforte auf. Erfrischende Kühle, wie sie diesen alt-ehrwürdigen Gemäuern eigen ist, streichelt über meine durchwärmten Arme und erfrischt mein erhitztes Gesicht. Bald schon durchzieht kräftiger Kaffeeduft die Räume (Bild 7).
Ich denke an Jesus, an dessen Leiden und Sterben wir uns heute erinnern wollen. Doch ich fühle alles andere als Trauer. Neben einem tiefen Empfinden innerer Ruhe eher große Dankbarkeit fürs Hiersein und bei mir sein dürfen an diesem Tag. Ostern eilt heran!
Karsamstag, 11. April 2020. Eine unruhige Nacht liegt hinter mir. Kurz nach Mitternacht wache ich mit einem Druck im Brustwirbelbereich auf. Bitte keine Panik jetzt. Es ist die Wirbelsäule, nicht die Lunge. Wahrscheinlich falsch gelegen. Ich versuche, eine ergonomisch bessere Liegeposition zu finden. Gegen fünf Uhr schrecke ich aus einem Traum hoch, in welchem mich ein heftiger Hustenanfall gepackt hatte. Ich schmecke Schleim in meinem Hals und frage mich, ob ich tatsächlich nur geträumt habe. Doch vom Virus infiziert? Nein, ich werde mich jetzt nicht verrückt machen mit irgendwelchen unsinnigen Spekulationen, obwohl die Themen Krankheit und Tod – auch aufgrund meines fortgeschrittenen Alters – immer wieder mal in meinen Gedanken herumgeistern.
Mein nachmittäglicher Spaziergang führt mich heute durch die Bärtlestraße (Bild 8). Ich besuche auf dem kleinen Friedhof neben der Pfarrkirche die Gräber von Maria Elisabeth Stapp und Josef Weiger. Zwei Gräber, die mir so vertraut sind, obwohl ich Friedhöfe eigentlich nicht mag und ein widerstrebendes Verhältnis zu Gräbern habe.
Am Ende der Straße, dort, wo sie in die Bundesstraße mündet, liegt in einer Wiese eine Reihe im Sonnenlicht leuchtender Weidekätzchenzweige, hingeworfen wie für ein Gemälde, bildhaft schön. Ich bin versucht, einen zu stibitzen. Doch eine Rebschere liegt noch griffbereit daneben. Wer immer hier am Werk war, wird bestimmt nicht weit sein.
Auf der anderen Straßenseite steht am Wegrand der Erinnerungs-Bildstock für den aus dem Dorf stammenden Pfarrer Josef Bärtle, ehemals Direktor das Katholischen Bibelwerks in Stuttgart. 1949 fand er, erst 57jährig, an eben dieser Stelle bei einer Fahrt mit seinem Moped den Tod. Kaum zu glauben ist dieses Unglück, führt die Straße hier doch schnurstracks geradeaus, und sie ist immer noch innerhalb des Ortes, sodass seine Geschwindigkeit nicht maßlos gewesen sein kann. Warum nur verlor er die Kontrolle über sein Gefährt?
Ich bin an meinen Sturz Anfang Februar mitten auf dem absolut ebenen Flur im Büro erinnert, den ich mir auch nicht erklären kann. Keine Stolperfalle, rein gar nichts, das sich mir in den Weg gestellt hätte. Und trotzdem lag ich plötzlich auf der Nase, genauer gesagt auf meiner rechten Seite. Die Schulter schmerzt heute noch, vor allem nachts. Eine Freundin meint, mir habe eine Verstorbene oder ein Verstorbener das Bein gestellt. Anders könne es gar nicht sein, als dass man auf ebener Fläche und ohne ersichtlichen sonstigen Grund ins Straucheln gerät und fällt. Für mich eine völlig absurde Idee! Wer aus dem Jenseits sollte ein Interesse daran haben, ausgerechnet mich mitten im Büro und noch dazu vor den Augen meines Chefs zu Fall zu bringen? Boshafte Geister, will ich an sowas glauben? Ich kann noch immer nur den Kopf über diese Vorstellung schütteln.
Zurück aber zu Josef Bärtle. Er hat den Sturz vom Moped nicht überlebt, konnte niemandem mehr erzählen, ob sich ihm irgendwas oder gar irgendwer, womöglich aus dem Jenseits, in den Weg gestellt hat, dem er hätte ausweichen wollen.
Ich erinnere mich an den Bericht einer Mooshausenerin, die damals als noch sehr kleines Mädchen mit ihren Eltern auf einem nahen Feld gewesen ist. Sie weiß nur noch, dass es einen Mordsschlag getan habe. Danach sei sie von ihren Eltern sofort nach Hause geschickt worden. Niemand war Augenzeuge vom Tod Josef Bärtles. Ganz allein ist er – verzeiht mir die kecke Wortwahl, die weiß Gott nicht angebracht ist – mit voller Geschwindigkeit in den Himmel eingefahren, um dort mit starken Armen aufgefangen und sanft gebettet zu werden. Wohin meine Gedanken mich führen…
Mir kommt ein anderer Leichnam in den Sinn an diesem Tag. Der, welcher gestern vom Kreuz abgenommen wurde von Josef aus Arimathäa, dem heimlichen Jünger, der sich nicht traute, aus der zweiten Reihe herauszutreten und sich zu Jesus zu bekennen. Angesichts des Todes wurde er stark, mutig. Genau dann, als alle aus der ersten Reihe ihren Mut verloren, verzweifelten, flüchteten. Wollte er etwas wiedergutmachen mit dem Kauf von feinstem Leinentuch, damit, dass er sein Grab, welches er für sich ausgesucht hatte, für die Bestattung des Leichnams Jesu auserkoren hat? Ob es ihn viel Überwindung gekostet hat, zu Pilatus hineinzugehen und um Jesu Leichnam zu bitten?
„Nur wenn ich schwach bin, bin ich stark“, schreibt Paulus später. Wie schwach muss Josef aus Arimathäa gewesen sein in diesem Moment, als Jesus tot am Kreuz hing, jetzt, da es definitiv zu spät zu sein schien, ihm zu folgen, sich zu ihm bekennen? Woher kam die Stärke, die ihn trieb, zu handeln, ungeachtet allen Geredes über ihn, das es sicher gegeben hat? Er war ein bekannter Mann.
Sein Handeln erscheint uns merkwürdig. Aber ich will ehrlich sein, auch ich bin nicht selten ein Josef aus Arimathäa (gewesen). Erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen scheint, spüre ich einen Drang, dass etwas aus mir herauswill, finde ich Kraft und vor allem Mut, mich zu bekennen, zu sprechen, zu handeln, einzustehen.
All diese Gedanken ereilen mich auf meinem Spaziergang. Sie sprudeln förmlich heraus, und ich bedauere, kein Schreibzeug dabei zu haben, damit ich sie gleich notieren kann und sie nicht wieder vergesse. Nun aber weiter auf meinem Weg.
Ich überquere einen Bahnübergang. Mir stechen zwei sich kreuzende Straßenschilder ins Auge. „Frauenmahdweg“ steht auf dem einen (Bild 9). Ich frage mich, welche Bedeutung dieser Name hat. Haben entlang dieses Wegs vornehmlich Frauen das Heu, das abgemähte Gras, die Mahd, gewendet, und ist aus dieser Fleißarbeit der Wegname entstanden? Ich entschließe mich, mich mit dieser Erklärung zufriedenzugeben. Wen könnte ich jetzt auch fragen, bin ich doch ganz allein unterwegs.
Die Straße führt bergauf zwischen Bäumen hindurch. Ein wenig Schatten kühlt, denn auch heute ist es sommerwarm. Zur Linken thront einladend ein flaschengrüner Nistkasten auf dem Stumpf eines gefällten Baumes (Bild 10). Einem Zwergenhäuschen gleich, lädt es zur Einkehr ein. Fehlt nur noch ein Schildchen mit der Aufschrift „Pension Waldblick“ oder „Zum fröhlichen Zwerglein“ oder wie auch immer. Ich kann nicht erkennen, ob es bewohnt ist.
Ein Postauto rast von der Höhe herab an mir vorbei. Der Fahrer scheint ortskundig. Denn am Beginn des Aufstiegs, war da nicht ein Durchfahrverbotsschild?
Steil und steiler geht es bergan. Zur Linken öffnet sich ein noch brachliegendes Feld. „Viel Steine gab’s…“, würde Klaus jetzt sagen. Es ist übersät mit Steinen in jeglicher Größe. Die Sonne brennt zwischen weißen Schäfchenwolken. Als sich vermeintlich ein Waldweg zur Rechten auftut, biege ich zielstrebig ein. Ein fast trocken liegendes Bächlein sumpft vor sich hin. Wo soll das Wasser auch herkommen, es zu füllen? Gab es diesen Winter doch so gut wie keinen Regen, von Schnee ganz zu schweigen.
Nach nur wenigen Metern ragt halbhohes, verwittertes Mauerwerk aus der Erde. Eine kleine Ruine, die allerdings noch nicht sehr alt zu sein scheint. Neugierig, wie ich bin, würde ich gern wissen, was sich einst darin verbarg. Doch es lässt sich nichts ausmachen, was meinen Wissensdurst stillen könnte.
Immer tiefer dringe ich ins Dickicht vor. Ein Weg ist nicht mehr wahrnehmbar. Weiter hinten vermute ich eine Klinge, eine Möglichkeit vielleicht, dort vorwärts zu kommen. Aber als ich an die Stelle gelange, geht es zu steil bergab, auf der gegenüberliegenden Seite ebenso steil bergan. Kein Pfad, nur auch hier ein fast ausgetrockneter Wasserlauf in der Tiefe. Also umkehren. Das staubtrockene Laub raschelt nicht, nein, es kracht förmlich unter meinen forschen Schritten. Nach Wild brauche ich bei diesem Lärm, den ich verursache, nicht Ausschau zu halten. Das Erdreich ist uneben. ‚Pass bloß auf, dass du nicht umknickst‘, denke ich. ‚Wenn dir hier etwas passiert, sodass du selber nicht mehr von der Stelle kommst, wer will dich in diesem Gestrüpp finden und hinaustragen?‘ ‚Hättest halt doch deine Eitelkeit über Bord werfen und die Walkingstöcke mitnehmen sollen!‘ ermahne ich mich selbst. Wie hätte ich wissen sollen, dass ich mich derart auf Abwege begebe? Ich überrasche mich gern selbst.
Wieder draußen auf dem geteerten Weg mühe ich mich weiter bergauf. Ein Zitronenfalter begleitet mich auf und ab tänzelnd ein Stück. An einem großen, schwerfälligen, hölzernen Wegkreuz machen zwei Radler Rast und grüßen freundlich zu mir herüber. Der Weg geht von geteert in feinen Schotter über, immer steiler werdend. Ob ich irgendwann Ausblick nach links auf das Massiv der Allgäuer Berge haben werde? Der Wald auf beiden Seiten will kein Ende nehmen. Ich habe Durst, habe aber nichts zu trinken dabei. Also entschließe ich mich, umzukehren und den gleichen Weg zurück zu nehmen. Die beiden Männer mit ihren Rädern sitzen noch immer, fröhlich schwatzend, auf der Bank unter dem Kreuz. Wo soll man an einem Karsamstag auch sonst sitzen?
Auf einer Wiese neben dem nahegelegenen Aussiedlerhof übt sich ein etwa zehnjähriger Junge gekonnt auf einem fahrbaren Rasenmäher. Er scheint mit Leidenschaft ganz bei der Sache. Vor der großen Ligusterhecke, die das Gelände rund ums Haus bezäunt, bewegt sich etwas und zieht merkwürdige Kreise. Bei näherem Hinsehen erkenne ich einen Mähroboter. Hightech hätte ich in dieser idyllischen Abgeschiedenheit nicht erwartet.
Der Zitronenfalter sucht noch immer seinen Durst zu stillen und labt sich an einer rosa Schlüsselblume. Kurz vor dem Bahnübergang überholen mich die beiden Radfahrer. Zwei junge Frauen kommen mir, vorschriftsmäßig den uns derzeit gebotenen Abstand einhaltend und in ein munteres Gespräch vertieft, entgegen. Auch sie grüßen freundlich. Im Vorübergehen schnappe ich das Wort „Französisch“ auf.
Es gab eine Zeit, da war ich sehr verliebt in diese Sprache. Bis zu dem Zeitpunkt als ich mich an der Uni mit deren Studium versuchte. Ein Trauma ist daraus erwachsen. Nicht, dass ich alles vergessen hätte, was ich mir damals in der Schule mit erfülltem Fleiß angeeignet hatte. Vielleicht überwinde ich meine innere Abwehr ja eines Tages und beschäftige mich wieder damit. Wer weiß!
Heute aber ganz bestimmt nicht mehr. Heute ist Karsamstag, der Tag, an dem die Abwesenheit Jesu schmerzlich spürbar, sein grausamer Tod betrauert sein soll. Ich beschließe, im Morgengrauen an sein Grab zu eilen mit Maria aus Magdala, der ersten Augenzeugin seines glorreichen Sieges. Kalì anastasì! Frohe Auferstehung! (Bild 11)
CHRISTUS IST AUFERSTANDEN. JA, ER IST WAHRHAFT AUFERSTANDEN. HALLELUJA. HALLELUJA.
Ostern ist da. Es ist frühmorgens, 12. April 2020. Noch ist es dunkel. Ich stehe an der Ecke eines Hauses mitten in Jerusalem. Leichter weißer Nebel schleicht über den Boden der Felsplattengassen und beginnt aufzusteigen. Ein sonniger Tag kündigt sich an. Immer wieder spähe ich ums bröckelnde Mauerwerk. Da, in einiger Entfernung bewegt sich etwas. Ob sie es ist?
Ich möchte Zaungast sein heute am Grab Jesu. Maria aus Magdala wird dort sein. Es ist tradiert, dass sie an diesem Tag, den wir den Ostermorgen nennen, in der Frühe zum Grab kam. Ich will ihr folgen, denn ich kenne mich nicht aus in dieser Stadt, weiß nicht, wo genau es sich befindet.
Durchs sich nur spärlich lichtende Dunkel huscht ein Schatten. Langsam tastet er sich voran, immer nah an den Mauern. Hin und wieder bleibt die Gestalt stehen und blickt sich spähend um. Sie kommt näher und näher. Ich drücke mich fest an die Hauswand und versuche, mich so unsichtbar als möglich zu machen. Der Schatten weht an mir vorbei. Ja, sie ist es, Maria aus Magdala. Obwohl ich ihr noch nie vorher begegnet bin, bin ich mir hundertprozentig sicher. Sie strahlt etwas Bemerkenswertes aus, etwas, das keinen Zweifel an ihrer Identität lässt. Über ihr nachtblaues bodenlanges Gewand hat sie einen ebensolchen Schleier geworfen, der sie fast komplett einhüllt. Ihr beinah wundersam leuchtendes Gesicht kann er nicht verbergen. Wie schön sie ist! Irgendetwas scheint sie an sich zu pressen. Vermutlich ein Gefäß mit einer von ihr am Vortag zubereiteten wohlriechenden Salbe aus Myrrhe und Aloe. Bestimmt will sie Jesu Leichnam noch einmal selber balsamieren.
Sie traut sich was, diese Maria aus Magdala. Ich weiß nicht, ob das von den Römern, geschweige denn von ihren Landsleuten gern gesehen ist, dass sie sich im Morgengrauen an diese düstere Stätte wagt. Hat sie sich, bevor sie sich auf den Weg gemacht, eigentlich überlegt, wie sie ins Grab hineingelangen will? Ganz sicher nicht. Wir wissen doch, dass es mit einem großen Stein verschlossen wurde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Frau, mag sie auch kräftig und agil sein wie diese Maria, es schafft, eine Felsplatte ohne fremde Hilfe zu bewegen. Aber sie, diese für ihre Zeit beachtenswerte Frau, ist getrieben von ihrem Willen, ihrem innigen Freund den letzten Liebesdienst zu erweisen. Egal, welche Steine ihr auch im Weg liegen. Sie kann ihn nicht loslassen, ehe sie nicht noch mal ganz alleine mit ihm war und sich versichert hat, dass er tatsächlich tot ist.
Sicher und wendig bewegt sie sich durch diese Stadt. Ein Garten, eher ein Olivenhain, tut sich vor uns auf. Bestimmt der Ort, an dem sich das Grab befindet. Während Maria eilt, pirsche ich vorsichtig in einiger Entfernung hinter ihr her. Jetzt hält sie inne. Ich stehe ebenfalls still, umfasse den Stamm des Baumes, der neben mir aufragt. Ein zarter Duft rieselt herab, etwas kitzelt meine Nase. Kleine Schmetterlingsblüten schwingen in der lauen Morgenluft. Ein Judasbaum. So heißt er heute. Das unverwechselbare Purpurrot seiner Blüten ist in der Dunkelheit nicht auszumachen. Ich denke an den Mann, nach dem er benannt ist. Was hat er wohl durchlitten, bevor er sich selbst gerichtet hat?
Maria steht noch immer an derselben Stelle, sie wirkt wie erstarrt. Ich wage mich etwas näher heran, verstecke mich hinterm knorrigen Stamm eines vermutlich jahrtausendealten Olivenbaums. Irgendetwas ist da ungewöhnlich. Aber was? Ich kneife meine Augen zusammen in der Hoffnung, besser sehen zu können. Ist das ein Felsen, vor dem Maria da verweilt? Meine Augen tasten die Konturen des Gebildes ab. Ja, es ist eindeutig ein Felsen. Das muss das Grab sein. Es scheint offen zu stehen. Es sieht aus, als ob sich jemand mit einer Kerze oder Laterne darin befindet, denn ein Lichtstrahl fließt, einem weißen faltigen Tuch gleich, heraus und durchbricht die Dunkelheit. Maria kann den Stein nicht weggeschoben haben. Das hätte ich doch bemerkt, wenn sie einen solchen Kraftakt vollzogen hätte. Aber ein Stein ist da eindeutig nicht. Es muss wohl vor ihr schon jemand gekommen sein.
Maria wirkt erregt. Was sie so in Unruhe versetzt? Sie spricht doch mit jemandem. Wer ist das? Vor allem wo ist jemand? Ich sehe nur Maria. Ihr Blick geht nicht in Richtung des Lichts. Eher an sein Ende. Bestimmt lehnt die Person hinter dem anderen Olivenbaum dort, der neben Maria aufragt. Ja, so muss es sein. Genau dorthin schaut sie. Wird das Grab etwa bewacht? Ist tatsächlich schon jemand da? Etwa andere Frauen, vom gleichen Vorhaben getrieben wie Maria?
Jetzt zittert sie buchstäblich und schwankt. Schon will ich aus meinem Versteck springen, um ihr zu Hilfe zu eilen. Doch da dreht sie sich um, sodass ich ihr Gesicht erkennen kann. Regelrecht erstarrt halte ich inne. Ich finde kein Wort, welches ausdrücken könnte, was ich in ihren Zügen lese. Es ist etwas ganz Neues, fast Übernatürliches. Ganz zu schweigen von diesem Strahlen in ihren pechschwarzen, kirschgroßen Augen.
Plötzlich rafft sie ihr bodenlanges Gewand und spurtet los, barfuß wie sie ist, als ob es gälte einen Olympiasieg zu erringen. Sie brescht an mir vorbei, ihr Ellbogen berührt beinahe den meinigen. Ich bin derart erschrocken, dass ich strauchle, obwohl sie mich nicht einmal touchiert hat.
Mit meinem Rücken rutsche ich am Stamm des Olivenbaums hinunter und kauere an seinem Fuß, die Kniee angezogen, die ich mit meinen Armen umschlinge. Mein Atem zittert, mein Herz klopft fast hörbar laut. Es ist also wahr. Der Leichnam, Jesus, ist nicht mehr in diesem Grab. Er war es, der hinter dem Baum, der mir den Blick auf ihn versperrt hat, stand. Mit ihm hat Maria gesprochen. Er lebt! Jesus lebt!
Ich kenne die Geschichte, weiß wohin Marias schnelle Füße sie tragen. Gleich werden sie kommen, erst der Jünger, den Jesus liebte, dann Simon Petrus. Ich sollte gehen, bevor sie auftauchen.
Fast bin ich ein wenig enttäuscht. Warum eigentlich? Was habe ich erwartet? Dass ich tatsächlich Zeugin sein darf, wie der Stein sich wie von Zauberhand vom Grabeingang schiebt und Jesus, in warmweißes Licht gehüllt, vor meinen Augen aus der dunklen Kammer hervortritt? Es stimmt, ich bin immer wieder ein zweifelnder Thomas, der hinterfragt. Auch ich wünsche mir manchmal, ich dürfte mit meinen Fingern Jesu Wunden berühren. Selig aber, die nicht sehen und doch glauben, ermahnt es in mir. Genauso oft wie ich im Glauben strauchle, „sehe“ ich allerdings auch. Nicht im wörtlichen Sinn mit meinen Augen. Es ist ein anderes „Organ“, das mich hierzu befähigt, mich in Sicherheit wiegen und mein Herz überströmen lässt von einer unerklärlichen Freude, auf meine Lippen ein Lächeln malt und meinem Gesicht, zumindest gefühlt, einen wahren Strahlenkranz verleiht. Zugegeben, diese Momente sind selten. Aber es gibt sie. Und immer, wenn ich hadere, rufe ich sie mir herbei, erinnere ich mich an all die Ereignisse, in denen sich ohne mein Zutun eine Tür aufgetan und eine Lösung dem vermutet Unlösbaren offenbart hat, vergegenwärtige ich mir diese unaufhörlichen Ostern, ohne die mein Leben trostlos und als gescheitert zu betrachten wäre.
Eine Hand, die mir vertraut scheint, legt sich behutsam auf meine Schulter und streichelt sie sanft. Jemand flüstert zärtlich meinen Namen: Christa. Ich blicke auf.
Ein Sonnenstrahl, der sich seitlich am Rollo vorbeischleicht, blendet mich und verkündet: Es ist Ostern, Zeit aufzuwachen, aufzukeimen, aufzubrechen.
Obwohl es uns derzeit verboten ist, zu reisen, bin ich heute in der Welt unterwegs. Von Jerusalem geht es weiter nach Rom. Ich verfolge die Ostermesse mit Papst Franziskus, die er in der Apsis des Petersdoms mit einer Handvoll Männern und zwei Nonnen zelebriert, begleitet von einer dezimierten Chorschola. Franziskus wirkt einsam, zutiefst bedrückt, alt. Sein schlechter Gang ist mir bereits an jenem Freitag aufgefallen, als er außerordentlich seinen Segen „Urbi et Orbi“ auf den verlassenen Petersplatz hinaus spendete. Der Himmel schüttete sich förmlich über den in der ganzen Welt berühmten Platz aus, als könne er dieses vor allem in Italien furchtbar kursierende Virus an diesem Abend einfach so hinwegspülen.
Wenn Franziskus das Wort erhebt, ist er kaum zu verstehen. Er spricht sehr undeutlich, brummelt geradezu in seinen nicht vorhandenen Bart. Seine Gesten sind umso wirkkräftiger. Er hat eigens das als wundertätig verehrte römische Kruzifix aus der Pestzeit in den Vatikan bringen lassen, ein lebensgroßes Abbild des Gekreuzigten. Es datiert zurück ins 14. Jahrhundert. Während der Pest 1522 war es in Prozessionen durch die Stadt getragen worden. Nach sechzehn Tagen ebbte die Seuche ab, erzählt man sich.
Diese Wirkkraft erhofft sich nun auch der Papst. Und gewiss nicht nur er. Wenn Franziskus vor diesem Kreuz steht und hinauf in das Antlitz Jesu blickt, sieht man förmlich, wie es in ihm brodelt, wie er, ohne die Lippen zu bewegen, spricht. Nicht gleich dem legendären italienischen Filmhelden Don Camillo oder dem bayerischen filmisch-kriminalisierenden Pater Braun, die laut und deutlich mit ihrem Herrgott am Kreuz feilschen. Aber genau wie diese beiden erweckt Franziskus den Anschein, als ob auch er ein sichtbares Zeichen vom Himmel, vom Kreuz herunter erwarte, erflehe.
Auch die berühmte Marien-Ikone Salus Populi Romani aus Santa Maria Maggiore, die aus dem Orient stammen soll, hat Franziskus in den Vatikan holen lassen. Sie ist ihm wohlvertraut. Es ist bekannt, dass er die Muttergottes sehr verehrt. Noch als Erzbischof von Buenos Aires kam er, wann immer er in Rom war, in die Basilika und besuchte die Ikone. Und als er zum Papst gewählt wurde, eilte er umgehend dorthin, um ihr sein Pontifikat anzuvertrauen. Auch vor und nach einer Papstreise ins Ausland kommt er jedes Mal, er betet nicht nur hier, er legt auch Blumen ab.
Ein großer Marienverehrer, unser Papst. Hat er doch im Saal der Casa Santa Marta, seinem vatikanischen Wohnsitz, eine Kopie des Gnadenbilds „Maria Knotenlöserin“ hängen, welches er Besuchern gerne präsentiert und erklärt. Das Original hängt in St. Peter am Perlach in Augsburg. Im Herzen bewegen mich die Worte des Gebets, wie es Josef Weiger einst formuliert hat, als er dieses Gnadenbild zum ersten Mal gesehen hat, und ich bin stolz darauf, das Erbe dieses Mannes mitbewahren zu dürfen. „Maria vom Knoten, der Knoten bin ich, ins Letzte verwirrt, o erbarme dich“, endet Weigers Gebet. Passen diese Worte nicht wunderbar in diese Tage? Die ganze Welt ein einziger Knoten, der unentwirrbar scheint.
Seine Ansprache an diesem Ostersonntag bewegt mich tief. Die Osterbotschaft sei eine „Ansteckung von Herz zu Herz“, nimmt er Bezug auf die Infektionswelle, die den Erdkreis seit Monaten umspült. Einsame Ostern müssten wir alle verbringen, auch ohne die Möglichkeit, Trost zu schöpfen aus den Sakramenten. Diese Zeit erlaube keine Gleichgültigkeit, denn die ganze Welt müsse nun zusammenstehen. Diese Zeit erlaube keinen Egoismus, und er appelliert hier in besonderer Weise an die Länder Europas. Diese Zeit erlaube kein Vergessen. Er verweist auf die zahlreichen Nöte, unter denen Menschen auf der ganzen Welt zu leiden haben, auf die Umstände in Asien und Afrika, in Venezuela und den Flüchtlingslagern Griechenlands, vor allem auf Lesbos. Er sagt klare Worte und erbittet Gottes Segen, den er allen Menschen als Ostergabe überreicht im Vertrauen auf Jesu Zusage: „Fürchtet euch nicht! Ich bin bei euch.“
Die Lammkeule mit Kartoffeln, Karotten, dicken weißen Bohnen, unser Ostermahl, war köstlich. Wenigstens kurz zieht es mich nach Erledigung aller haushälterischen Arbeiten wieder hinunter zum Illerkanal. Ein lauer Wind weht heute auf und lässt die Wasseroberfläche sich kräuseln. Ich bin die einzige Spaziergängerin und komme mir in der Tat sehr verlassen vor. Einfach nur spazieren gehen scheint in dieser Gegend verpönt. Wenn man sich schon nach draußen begibt, dann mit Walkingstöcken, Inlineskatern, Fahrrädern, Mountainbikes. Vermutlich ist einfaches Spazierengehen viel zu unsportlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit der Empfehlung, in diesen Zeiten zu Hause zu bleiben, zusammenhängt. Denn Radler sind auch heute zu genüge unterwegs. Am Wehr tummeln sie sich geradezu, und ich muss eine Weile warten, ehe ich auf dem schmalen Steg den Kanal passieren kann, ohne dass wir uns zu nahe kommen.
Mein Blick wandert nach rechts, wo ich einen hölzernen Wegweiser ausmache. „Maria Steinbach 9 km“ ist hineingeschnitzt. Ich wünschte, meine Freundinnen und Freunde, die vor zwei Jahren bei mir zu Gast waren im alten Pfarrhaus, wären jetzt hier. Wir hatten wahrhaft ein erfülltes Wochenende. Aber wie am Karfreitag notiert, waren die Spazier- und Wanderwege rund um Mooshausen von mir noch völlig unerforscht, sodass wir uns nur wenig die Beine vertreten haben. Jetzt locken wahre Geistesblitze, was hätte sein können. Mit Kaffee und Kuchen in den Rucksäcken hätten wir uns aufgemacht, um uns auf der großen Kiesbank über der Iller drüben daran zu ergötzen (Bild 12). Meine Phantasie malt ein bezauberndes Bild: Drei große Picknickdecken sind dort ausgebreitet. Ulrike, in einem leichten, rosabeblümten Baumwoll-Seidenkleid, mit stufenweisen Volants bis hinunter zu ihren Knöcheln, einen Regenschirm als Sonnendach über ihrem Haupt, in Pose gesetzt wie für ein Gemälde von Monet. Sabina in weißer Siebenachtelhose, ihre schmale Figur betont von einem Glamour-Shirt, unsere wilde Hummel, auch jetzt in Bewegung. Hektisch streift sie sich die verloursledernen, dreilagig mit Fransen drapierten Sandalen von den Füßen, um vorsichtig und barfuß, ihre Arme nach rechts und links ausgebreitet bis zum Rand der Kiesbank balancierend die Temperatur des Wassers zu erfühlen (Bild 13). Judith, bescheiden in einer rauchblauen Jeans und grün-weiß-rot-karierter Bluse. In Seelenruhe packt sie die Campingbecher und -teller aus, stellt Thermoskannen, Milch und Zucker bereit und öffnet die mitgebrachten Tupperdosen, denen verführerischer Kuchenduft entströmt. Franz-Josef und Peter in verkürzbarer Trekkinghose, der erste im beigen Leinenhemd, der zweite im unvermeidlichen Poloshirt. Eben packt er seine Gitarre aus, die mitzuschleppen er keine Mühe scheute. Sogar Liederbücher zieht er aus seinem Gepäck, und bald schon schallt „Marmor, Stein und Eisen bricht“, „Heute hier, morgen dort“, „Rote Lippen soll man küssen“, „Guantanamera“ und auch „Ubi caritas“ über die Iller hinweg.
Eine Wanderung nach Maria Steinbach, neben Altötting, Ettal, Einsiedeln und der Wieskirche einer der bedeutendsten Wallfahrtsorte im deutschsprachigen Süden, wie ich eben in Wikipedia lese, wäre auch absolut gefällig gewesen. Oder hinüber zur Kartause Buxheim, nur halb so weit, mit seinem unvergleichlichen, aufsehenerregenden Chorgestühl, das die halbe Welt bereist hat, ehe es 1980 nach über siebenundneunzig Jahren dorthin zurückgekehrt ist. Ich beschließe, umgehend nach meiner Rückkehr ins Pfarrhaus eine Mail in die Runde zu schicken, in der ich meine Entdeckungen schildere und den Wunsch äußere, wir mögen doch noch einmal hier zusammenkommen und miteinander in dieser vom Schöpfergeist begnadeter Persönlichkeiten durchwebten Allgäuer Lieblichkeit umherpilgern. Mein nicht mehr jugendliches Herz hüpft freudig erregt in meiner Brust, so sehr hofft es auf Erfüllung. Gemächlich heimwärts schlendernd schmiede ich bereits ausgiebig Pläne, ohne weiter groß auf meine Umwelt zu achten. Mein Streben gilt nun dem, was kommen und möglich sein könnte, wenn erst einmal die Pandemie überwunden ist.
Viel zu schnell ist es Abend geworden an diesem Ostersonntag. Ich begehre nur eines in dieser Stunde: dass der Friede, mit dem der Auferstandene in jenen Tagen seine Jünger begrüßt hat, und der uns allen zugesichert ist, dauerhaft Heimat finden möge auf dieser Erde, in den Ländern, in den Städten, in den Dörfern, den Häusern, den Herzen und dort verweilen möge auf ewig. Halleluja, Halleluja!