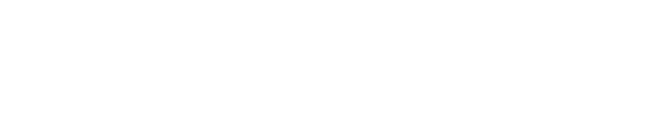Wort zum Sonntag, 29. März 2020
Vorösterlich – ein Blick auf den Tod
„Sein ganzes Leben leben, seine ganze Liebe lieben, seinen ganzen Tod sterben“, sagte Teresa von Avila in einem ihrer großen Sätze. Alles ganz tun. Aber weil wir Vieles halb tun, mogeln wir uns auch am Tod vorbei. „Ich habe keine Angst vor dem Sterben, ich möchte nur nicht dabei sein, wenn es passiert“, spottete der Komiker Woody Allen. Schnell umfallen und nichts merken, das wäre Glück (meint man).
Oder: Wenn man den Umfragen traut, ist vielen Menschen der indische Glaube an die Wiedergeburt ein Trost. Warnung: Dann gibt es auch den hundertfach wiederholten Tod… den dauernden Kreislauf… Ein bißchen gestorben sein, wieder ein bißchen leben? Und das immerfort weiter? Es gibt ein großes Nein dazu: das Nein der Liebe. Will die Frau, die ihren Mann liebt, daß er irgendwo anders als Kind wiederkommt, auch als Hund, als Pflanze – denn die „Wiedergeburt“ läuft durch alle Lebensstadien? Ist es ein Trost, wenn der tote Geliebte als Eskimojunge oder als Nachbarstochter wiedergeboren wird? Nein, sie liebt ihn, diesen Einen, und nicht bis zur Unkenntlichkeit ausgetauscht. Denn das hieße ja, daß ihre Liebe unwichtig wäre, ganz vergessen werden könnte; im nächsten Dasein käme eine andere Frau mit anderen Kindern daran – und das tausend Mal und unendlich so fort. Genauso grausam ist der Gedanke, selbst schon tausend Lieben begonnen – und vergessen zu haben. Denkt man das durch, dann beginnt einem schwindlig zu werden.
Daher hat Indien selbst als Antwort den Weg des inneren Sterbens entwickelt, der allem Glück und aller Enttäuschung vorgängig ist, um das Unglück des Geborenseins zu entgiften. Sterben vor dem Sterben, lautet die Lösung Buddhas. Seine Askese arbeitet auf ein Sterben hin als wirklich letzten Absprung, als „Flucht aus dem brennenden Haus“, wobei der Springende und Flüchtende sich endgültig auflöst. Das Leid verschwindet, weil der Leidende selber verschwindet.
Die Erfahrung Israels von Gott wie vom Menschen erhebt sich in einem deutlich unterschiedenen Horizont. Gott ist weder eine gesichtslose Fruchtbarkeit, ein anonymer „Weltgrund“, der mich wieder ins Leben zurückwirft. Noch ist Gott die gesichtslose Vernichtung, ein alles auflösendes „Nichts“.
Die Liebe sagt nein zu diesem Zerfließen der Konturen, um des Ernstes der Liebe willen. Gott fordert nicht den Menschen, der sich selbst in einer „Wiedergeburt“ abhanden kommen oder ins Nichts abstürzen soll. Er will den Menschen, der Antwort, Entscheidung, Einsatz formulieren kann. Sterben soll Entscheidung sein: zum letzten Gegenübertreten „von Angesicht zu Angesicht“. Eben darin erfährt der Mensch sein Gericht: im Sinn von Aufrichten und Geraderichten. Denn das ist großes Glück: endlich aufgerichtet sein zu seiner vollen Größe.
So wird nicht nur die Liebe, sondern auch der Tod ernst. Es gibt kein Probesterben. Denn mir ist versprochen: anstelle von Endlosigkeit oder Nichts die Voll-Endung. Anstelle des lähmenden Kreislaufs: endgültig jenen alles verstehenden, sanften Blick auf mir ruhen fühlen, vor dem sich das rätselhaft Verworrene des eigenen Daseins, die mir selbst undurchdringliche Mischung von Schuld und Verhängnis löst – jene unleserlichen Muster auf der Rückseite des Lebensteppichs. Mehr noch: zu erfahren, daß alles erhalten bleibt, was bisher geliebt wurde – die Freunde wiederzusehen, die früher schon in das schmerzliche Dunkel hinein verloren wurden. Auch sie zeigen sich dann in der „wahren“ Gestalt, die mehr oder minder verborgen war.
Warum dann ein Tabu des Todes auch unter Christen? Und warum doch Schaudern vor dem Tag des eigenen Abtretens? Weil die Natur etwas vollzieht, was nicht nur ohnmächtig macht, sondern mit Schmerz, Zerfall und Häßlichkeit einhergeht – bis zur Verwesung. Von unserer Erfahrung aus sind diese Auflösungen angstvoll, wir scheuen sie mit Recht. Also muß unser Vertrauen größer sein als unsere Angst. So ist es sinnvoll, sich „zur rechten Zeit“ mit dem eigenen Tod zu „befreunden“, mit der letzten großen Möglichkeit: sein Leben in eine Schale der Hingabe zu sammeln, das Haus zu bestellen, Schuld(en) zu bereinigen – und mit großem Vertrauen in das unleugbare Dunkel hineinzugehen, das den Tod umgibt. Warum Vertrauen? Weil es die Erfahrung gibt, daß der Tod nicht Ende und Abbruch, sondern wunderbarer, unausdenklicher Neubeginn ist. Das ist Inhalt und Entzücken der Evangelien und der Apostelbriefe: Daß sich der Herr selbst in das Schreckliche hineingeworfen hat, ja, begraben wurde, daß er selbst „hinabstieg“, um durch das Land der Toten zu wandern, ein für allemal durch den Fluß der Schuld zu waten und die Welt hindurchzutragen. Und daß es danach eine Explosion der Freude gab, den Sprung in das Ewige, genauer: in die unvorstellbar berührende ewige Liebe.
Wie läßt sich das alles behaupten? Dadurch, daß der Herr selbst „noch eins draufgesetzt hat“: seinen verklärten Leib. Leibhaft zeigte er sich, ließ sich betasten, aß Fische und Brot… Daß er sein Fleisch nicht verlor, sondern strahlend behielt (ja, auch die Wunden strahlten!), ist die Anzeige dafür, daß der Geist den irdischen, selbst den verwesten Leib verwandelt. Der Sterbende darf sich selbst, auch seinen Leib, über die Todesschwelle hinaus zur vollen Schönheit entfalten.
So ist christliche Kunst des Sterbens: das Alte loslassen, um es verjüngt und erneuert wieder zu gewinnen, im göttlichen Ursprung. Dabei hilft zutiefst, daß das auf uns wartende Antlitz selbst auch einmal ein sterbendes war, uns den Weg schon gebahnt hat: „Wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten kraft deiner Angst und Pein.“ So kann das eigene Nach-Sterben in gelöstes Leben münden. Sterben ohne Tabu kann der, der das kommende Leben liebt. Mehr noch: der den Lebendigen, antlitzhaft, anzutreffen hofft. Der Psalm (16,15) benennt das ganz große Glück: „Ich aber werde Dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit; und einstens, wenn ich erwache, satt mich sehen an Deiner Gestalt.“
Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz